
Die Spannungen und Rivalitäten des Kalten Krieges spielten sich häufig auch im Sport ab. Wie bei der Technologie und der Weltraumforschung war auch der Sport ein Bereich, in dem rivalisierende Mächte ihre Dominanz unter Beweis stellen oder behaupten konnten, ohne in den Krieg zu ziehen. Der Sport im Kalten Krieg könnte daher stark politisiert sein. Westliche Länder und Sowjetblockstaaten investierten stark in die sportliche Ausbildung und Entwicklung, insbesondere in Sportarten mit internationalem Wettbewerb. Die Olympischen Spiele wurden zu einem wichtigen Schauplatz dieser Rivalität. Wie Nazis in 1936, versuchten die Supermächte des Kalten Krieges, die Olympischen Spiele für politische und ideologische Vorteile auszunutzen. Bei den Olympischen Spielen kam es zu vielen bemerkenswerten Zusammenstößen zwischen Teilnehmern des Kalten Krieges. Diese Wettbewerbe erregten großes Medieninteresse und einige endeten chaotisch oder kontrovers. Die Olympischen Spiele dienten auch als Bühne für politische Proteste, etwa für umstrittene Boykotte Anfang der 1980er Jahre. Auch Sport im Kalten Krieg könnte konstruktiv sein. Sport diente gelegentlich als Eisbrecher. Das Interesse am Sport bot eine gemeinsame Basis und eine Gelegenheit für politische Rivalen, zu kommunizieren und bessere Beziehungen aufzubauen.
Die Sowjetunion (UdSSR) nahm an den Olympischen Sommerspielen zwischen den beiden Weltkriegen nicht teil. Die UdSSR wurde 1948 zu den Olympischen Spielen in London eingeladen, lehnte dies jedoch offenbar ab, weil Josef Stalin war besorgt darüber, dass die sowjetischen Athleten nicht dem Weltstandard entsprachen. Moskau unternahm intensive Vorbereitungen für die Olympischen Spiele 1952 in Helsinki, Finnland. Dies wurde bestätigt, als die Sowjetunion fast 300 Athleten nach Helsinki schickte und 71 Medaillen gewann, davon 22 Goldmedaillen. Moskaus anhaltende Konzentration auf den Sport zahlte sich 1956 aus. Die sowjetische Mannschaft dominierte die Olympischen Winterspiele 1956 in Italien und gewann 16 Medaillen. Auch bei den Olympischen Sommerspielen in Melbourne, Australien, belegten die Sowjets mit 98 Medaillen (37 Goldmedaillen) den ersten Platz in der Medaillenliste. Dies waren die meisten Medaillen, die jemals eine einzelne Nation bei Olympischen Spielen gewonnen hat, und übertreffen damit die 74 Medaillen der Vereinigten Staaten (32 Goldmedaillen). Mitglieder der sowjetischen Mannschaft wurden bei ihrer Rückkehr aus Melbourne als Helden gefeiert; 17 wurden mit dem prestigeträchtigen Lenin-Orden ausgezeichnet.

Moskau investierte weiterhin viel, um den olympischen Erfolg sicherzustellen. Athleten, die olympische Medaillen gewannen oder nationale oder Weltrekorde brachen, wurden Geldprämien oder Sachleistungen versprochen. Sportanlagen, Akademien, Trainer- und Trainingsprogramme erhielten alle beträchtliche staatliche Mittel. Zwischen 1960 und 1980 investierte die Sowjetregierung stark in die Sportinfrastruktur, verdoppelte die Zahl der Stadien und Schwimmbäder und baute fast 60,000 neue Turnhallen. Erfolgreiche Sportler wurden in der Staatspresse und Propaganda gefeiert. Normale Bürger wurden zur Teilnahme am Sport ermutigt und Sportprogramme wurden in sowjetischen Schulen zur Pflicht. Talenterkennungsprogramme entdeckten vielversprechende junge Sportler, denen staatlich finanzierte Trainerausbildungen oder Stipendien angeboten wurden. Die Sowjetunion schloss sich vielen internationalen Sportverbänden an und beherrschte mehrere Sportarten – sogar Sportarten mit einer begrenzten Geschichte in Russland, wie Basketball, Volleyball und Fußball.
„Was die Ostdeutschen von den anderen Athleten der Welt unterschied, war nicht, dass einige (nicht alle) an der Einnahme von Steroiden teilnahmen, sondern dass ihr Programm geplant war. Zu beachten ist, wie wichtig die obligatorische Körperkultur im ostdeutschen Leben ist, wie viele hochqualifizierte Trainer und freiwillige Ausbilder im Land gearbeitet haben und wie wachsam es ist, Menschen mit sportlichem Potenzial zu finden und auszubilden. “
James Riordan, Historiker
Andere kommunistische Nationen haben ähnliche Investitionen in den Sport getätigt. Ost-Deutschland (DDR) legte großen Wert auf sportliche Leistung, was vor allem auf die intensive Rivalität mit der Bundesrepublik Deutschland zurückzuführen war. Keines der beiden deutschen Länder nahm an den Olympischen Spielen 1948 teil, während Ostdeutschland die Spiele 1952 boykottierte, nachdem das Internationale Olympische Komitee (IOC) auf einer einheitlichen deutschen Mannschaft bestand. Die DDR entsandte 1968 zum ersten Mal eine eigene Olympiamannschaft, deren Athleten mit 25 Medaillen (neun Goldmedaillen) den fünften Platz in der Medaillenliste belegten. Die Olympischen Spiele 1972 in München waren ein Triumph für die Ostdeutschen. Das DDR-Team nahm an 18 Sportarten teil und belegte in der Medaillenliste den dritten Platz (40 Medaillen, 13 Goldmedaillen) – 26 Medaillen vor dem Gastgeberland Westdeutschland. Trotz seiner relativ geringen Bevölkerungszahl von 16 Millionen Menschen entwickelte sich Ostdeutschland in den 1970er und 1980er Jahren zu einer der erfolgreichsten Sportnationen, insbesondere in den Bereichen Leichtathletik, Schwimmen, Rudern und Turnen. Die ostdeutsche Mannschaft belegte bei den Olympischen Spielen 1976, 1980 und 1988 den zweiten Platz in der Medaillenwertung hinter der Sowjetunion (wie die UdSSR boykottierte die DDR die Spiele 1984 in Los Angeles). Auch bei fünf Olympischen Winterspielen in Folge belegten Ostdeutsche den ersten oder zweiten Platz. Das ostdeutsche Sportprogramm wurde später durch Dopingvorwürfe und weit verbreiteten Steroidkonsum getrübt, obwohl wenig bewiesen wurde.

Die Olympischen Spiele in Melbourne (1956) waren ein bemerkenswertes Beispiel dafür, wie sich politische Spannungen auf den Sportbereich auswirkten. Zwei Wochen vor der Eröffnungsfeier marschierten sowjetische Truppen ein Ungarn, setzte die reformistische Regierung von ab Imre Nagy und tötete mehr als 2,000 ungarische Demonstranten. Anschließend traf die ungarische Wasserballmannschaft im Halbfinale auf die Mannschaft der Sowjetunion. Während dieser Begegnung, die später als „Blood in the Water“-Match bezeichnet wurde, lieferten sich beide Teams Beleidigungen, Tritte und Schläge. Die grobe Taktik der ungarischen Mannschaft verunsicherte die Sowjets, die vier Gegentore kassierten, ohne selbst ein Tor zu erzielen. Gegen Ende des Spiels wurde der ungarische Spieler Ervin Zador von seinem sowjetischen Gegner am Kopf getroffen. Zador verließ das Becken blutend mit einer Schnittwunde im Auge und das Spiel wurde eine Minute vor Spielende abgebrochen. Die sowjetische Mannschaft wurde vom australischen Publikum ausgebuht und angespuckt, als die Spieler die Arena verließen. Ungarn erreichte das Finale, wo es Jugoslawien mit 2:1 besiegte und die Goldmedaille gewann. Die sowjetische Mannschaft musste sich mit Bronze begnügen.
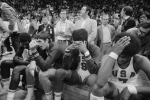
Ein weiteres bemerkenswertes olympisches Aufeinandertreffen war die Basketballmannschaft der Männer der Vereinigten Staaten und der Sowjetunion bei den Olympischen Spielen 1972 in München. Beide Nationen verfügten über leistungsstarke Teams mit langjähriger Erfolgsgeschichte. Das US-Team, das damals eher aus College- als aus Profispielern bestand, hatte bei den letzten sieben Olympischen Spielen Gold gewonnen. Die sowjetische Mannschaft war regelmäßig Olympia-Silbermedaillengewinner und Europameister. Die US- und die sowjetische Mannschaft wurden in München in verschiedenen Gruppen gelost. Beide erreichten relativ problemlos das Finale, wobei die Sowjets Kuba besiegten und die Amerikaner im Halbfinale Italien besiegten. Das Spiel um die Goldmedaille erregte angesichts der Stärke beider Mannschaften und der politischen Rivalitäten ihrer Nationen große mediale Aufmerksamkeit. Die Sowjets führten die meiste Zeit des Spiels, doch in den letzten Sekunden kämpften sich die Amerikaner zurück und führten mit einem Punkt Vorsprung. Fehler und Verwirrung zwischen Zeitnehmer und Schiedsrichtern ermöglichten es den Sowjets, das Spiel auf ihr Ende zu verlagern und den Siegkorb zu erzielen. Der 51:50-Sieg der Sowjets sorgte für Aufruhr im US-Lager, das behauptete, der letzte Spielzug sei unrechtmäßig. Amerikanische Beamte legten erfolglos Protest ein und legten dann Berufung beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) ein. Die US-Spieler weigerten sich, die Silbermedaille anzunehmen, eine Haltung, die sie seitdem beibehalten haben.
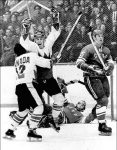
Die USA waren nicht die einzige westliche Nation, die eine heiße Rivalität mit der Sowjetunion genoss. 1972 initiierten kanadische und sowjetische Diplomaten in Moskau eine Reihe von Eishockeyspielen zwischen den beiden Ländern. Diese Serie von acht Spielen, vier in jedem Land, wurde im September 1972 ausgetragen. Ursprünglich als „Friendship Series“ bezeichnet, wurde sie als Summit Series bekannt. Sportlich war die Summit Series ein Erfolg und brachte hochwertiges Eishockey hervor. Kanada ging als Favorit in die Serie, war aber in seinen vier Heimspielen geschockt und lag nach vier Spielen mit 2:1 gegen die Sowjets zurück. Die Serie löste ein intensives Medienecho aus und löste auf beiden Seiten nationalistische Stimmungen aus. Auf dem Spielfeld wurde es durch Behauptungen über voreingenommenes Schiedsrichterwesen, kontroverse Taktiken und Spielgeist auf beiden Seiten getrübt. Im sechsten Spiel wurde dem kanadischen Spieler Bobby Clarke vorgeworfen, Valeri Kharlamov im sechsten Spiel absichtlich verletzt zu haben und sich dabei den Knöchel gebrochen zu haben. Kanada gewann die Serie mit 4:3, doch das hohe Niveau der sowjetischen Spieler überraschte ihre Gegner.
Die Olympischen Spiele wurden gelegentlich zu einer Plattform für politische Missstände. Bei den Spielen 1968 in Mexiko-Stadt war die Tschechoslowakin Vera Caslavska - eine Weltmeisterin und eine ausgesprochene Kritikerin von Sowjetischer Kommunismus in ihrer Heimat - drehte während des Spiels der sowjetischen Hymne den Kopf weg. Kommunistisches China wurde vom IOC nicht anerkannt und nahm daher zwischen 1956 und 1980 nicht an den Olympischen Sommerspielen teil. Die Mannschaft der Republik China (Taiwan) boykottierte die Olympischen Spiele 1976, nachdem Gastgeberland Kanada sich geweigert hatte, seine Souveränität anzuerkennen. Die größten Olympia-Boykotte gab es jedoch in den 1980er Jahren. 1980 weigerten sich die Vereinigten Staaten und mehrere andere Länder aus Protest dagegen, an den Olympischen Spielen in Moskau teilzunehmen Sowjetische Invasion in Afghanistan. Stattdessen veranstalteten die USA eine "alternative Olympiade", die Liberty Bell Classic, an der Athleten aus 29 Ländern teilnahmen. Die Sowjetunion und 14 Sowjetblocknationen revanchierten sich, indem sie die Spiele von 1984 in Los Angeles boykottierten. Auch die Sowjets organisierten ihren eigenen alternativen Karneval, die Freundschaftsspiele.

Der Sport im Kalten Krieg war oft konfrontativ – aber gelegentlich auch konstruktiv. Es gibt kein besseres Beispiel als die Rolle des Tischtennis bei der Wiederherstellung der amerikanisch-chinesischen Beziehungen. 1971 tourten Mitglieder der amerikanischen Tischtennismannschaft durch Japan und freundeten sich mit Mitgliedern der chinesischen Mannschaft an. Chinesische Beamte antworteten, indem sie das amerikanische Team zu einem Besuch in ihrem Land einluden. Die Einladung wurde angenommen und das amerikanische Team tourte im April 1971 durch China. Dieser Besuch, der Schauspiele und Besuche in der Verbotenen Stadt und der Chinesischen Mauer beinhaltete, löste in beiden Ländern große Neugier und Medienaufmerksamkeit aus. Während die Einladung zweifellos von chinesischen Führern ins Leben gerufen wurde, diente Tischtennis als diplomatischer Eisbrecher und ermöglichte Vertrauens- und Wohlwollenbekundungen ohne Anzeichen politischer Schwäche. Diese sogenannte „Ping-Pong-Diplomatie“ ebnete den Weg für Besuche und Treffen auf höherer Ebene und schließlich für eine Annäherung zwischen China und den USA. Drei Monate nach der Amerika-Tournee US-Außenminister Henry Kissinger besuchte China für geheime Gespräche mit Zhou Enlai. Kissinger wurde vom Präsidenten gefolgt Richard Nixon, der Peking besuchte und traf Mao Zedong im Februar 1972. China wurde später als Mitglied der Vereinten Nationen aufgenommen, während Washington die diplomatische Kommunikation mit Peking wiederherstellte.

Die Goodwill Games waren ein weiteres Beispiel dafür, wie Sport genutzt wurde, um die Wunden des Kalten Krieges zu heilen. Die vom amerikanischen Sender Ted Turner entwickelten und von seiner Firma Time Warner organisierten Goodwill Games sollten die Erbitterung der Olympia-Boykotte von 1980 und 1984 überwinden. An den ersten Goodwill Games, die im Juli 1986 in Moskau stattfanden, nahmen rund 3,000 Athleten teil aus 79 verschiedenen Nationen. Diese Spiele waren sowohl auf als auch neben dem Spielfeld ein voller Erfolg. Sie waren jedoch nicht ohne politische Probleme, da Moskau Athleten aus Israel und Südkorea verbot. Vier weitere Goodwill Games fanden statt: in Seattle (1990), Sankt Petersburg (1994), New York City (1998) und Brisbane (2001). Aufgrund der schlechten Einschaltquoten im Fernsehen, des nachlassenden Interesses der Sportler, des Endes des Kalten Krieges und der Verbesserung der internationalen Beziehungen wurden sie dann aufgegeben. Obwohl er bei den Goodwill Games Millionen von Dollar verlor, bedauerte Turner nichts und behauptete, seine Kreation habe eine entscheidende Rolle bei der Entspannung der Spannungen im Kalten Krieg gespielt.
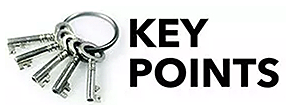
1. Während des Kalten Krieges nutzten viele Nationen den Sport zu politischen oder ideologischen Zwecken, um beispielsweise die Überlegenheit ihres Systems gegenüber anderen zu demonstrieren.
2. Von den späten 1940 an investierte die Sowjetunion stark in den Sport und schuf Infrastruktur und Programme, um neue Sporttalente zu identifizieren, zu entwickeln und auszubilden.
3. Diese staatliche Finanzierung zahlte sich für die UdSSR bei ihren ersten beiden Olympischen Spielen aus. Die DDR schlug einen ähnlichen Weg ein und wurde eine dominierende Sportnation in den 1970s.
4. Die Spannungen im Kalten Krieg führten zu einigen kontroversen oder gewalttätigen olympischen Zusammenstößen, wie zum Beispiel dem berüchtigten "Blood in the Water" -Match zwischen den sowjetischen und ungarischen Wasserballteams in Melbourne, 1956.
5. Sport trug gelegentlich dazu bei, die Spaltungen des Kalten Krieges zu heilen, indem er eine bessere Kommunikation und guten Willen förderte. Die US-chinesische "Ping-Pong-Diplomatie" (1971-72) und die Goodwill Games (1986-2001) waren Beispiele dafür.
Der Inhalt dieser Seite unterliegt dem © Alpha History 2018-23. Dieser Inhalt darf ohne Genehmigung nicht erneut veröffentlicht oder verbreitet werden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Nutzungsbedingungen.
Diese Seite wurde von Jennifer Llewellyn und Steve Thompson geschrieben. Um auf diese Seite zu verweisen, verwenden Sie das folgende Zitat:
J. Llewellyn & S. Thompson, „Sport in the Cold War“, Alpha History, abgerufen [heutiges Datum], https://alphahistory.com/coldwar/sport-cold-war/.
